Ausgabe 03/2024
Weil Arbeit eine Rolle spielt

Vier Jahre nach seiner Veröffentlichung erfährt der Roman von Thorsten Nagelschmidt nun eine Renaissance. Einerseits gibt es „Arbeit“ jetzt auch als Hörspiel, das von bekannten Künstler*innen wie Jasmin Tabatabai und Axel Prahl, aber auch von Nagelschmidt selbst vertont wurde. Andererseits wurde er für die Reihe „Berlin liest ein Buch“ ausgewählt, was seine Präsenz in der kulturellen Landschaft der Stadt erneuert. Darüber hinaus liegen mittlerweile auch Anfragen für eine Verfilmung vor.
Thorsten Nagelschmidt versteht es geschickt, die Schicksale seiner Figuren miteinander zu verflechten. Die Charaktere sind dabei häufig typisch Berlin: ein wenig ruppig, etwas resigniert. Dennoch begegnen sie den Widrigkeiten ihres Daseins mit einer ironisch gefärbten Fröhlichkeit.

ver.di publik: Dein Roman hat nach Erscheinen schon die Leserinnen und Leser begeistert. Wie fühlst du dich angesichts seines überraschenden Comebacks?
Nagelschmidt: Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, was jetzt alles mit dem Buch passiert, vier Jahre nach dem Erscheinen. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Roman im ersten Lockdown erschienen ist, wo deutschlandweit die meisten Buchhandlungen geschlossen waren. Natürlich sind damals alle Veranstaltungen – ich mache sonst immer sehr viele Lesungen – ausgefallen. Da habe ich mich schon manchmal gefragt, was wohl mit dem Buch passiert wäre, wenn es in einer nicht so eingeschränkten Zeit rausgekommen wäre.
Aufmerksamkeit bekommt es nun umso mehr. Das Hörspiel wird quer durch Deutschland auf vielen Radiosendern gespielt und es sind viele Lesungen geplant.
Naja, es sind drei Sender – RBB, NDR und MDR. Darüber freue ich mich total. Und auch durch die Berliner Veranstaltungsreihe „Berlin liest ein Buch“ könnte der Text nochmal eine ganz neue Leserschaft bekommen. Es wird von Mai bis August 18 Lesungen in allen zwölf Berliner Bezirken geben, überwiegend in Bibliotheken, wo teils sicher ein ganz anderes Publikum kommen wird als das, das ich bisher so erreicht habe. Das wünsche ich mir natürlich zum einen als Autor, aber auch für den Text. Denn es ist ein Text, der mit der Gesellschaft zu tun hat, in der wir leben und in der wir uns bewegen, und dem ich ein großes Publikum wünsche.
Und die Themen sind natürlich weiterhin aktuell.
Das Hauen und Stechen in der Gesellschaft ist nach der Pandemie nicht gerade kleiner geworden, die prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen sind nicht einfacher. Im Gegenteil. Deshalb sind dieser Text und die Probleme der Protagonisten in diesem Buch, immer noch sehr aktuell. Vielleicht sogar noch aktueller als vorher.
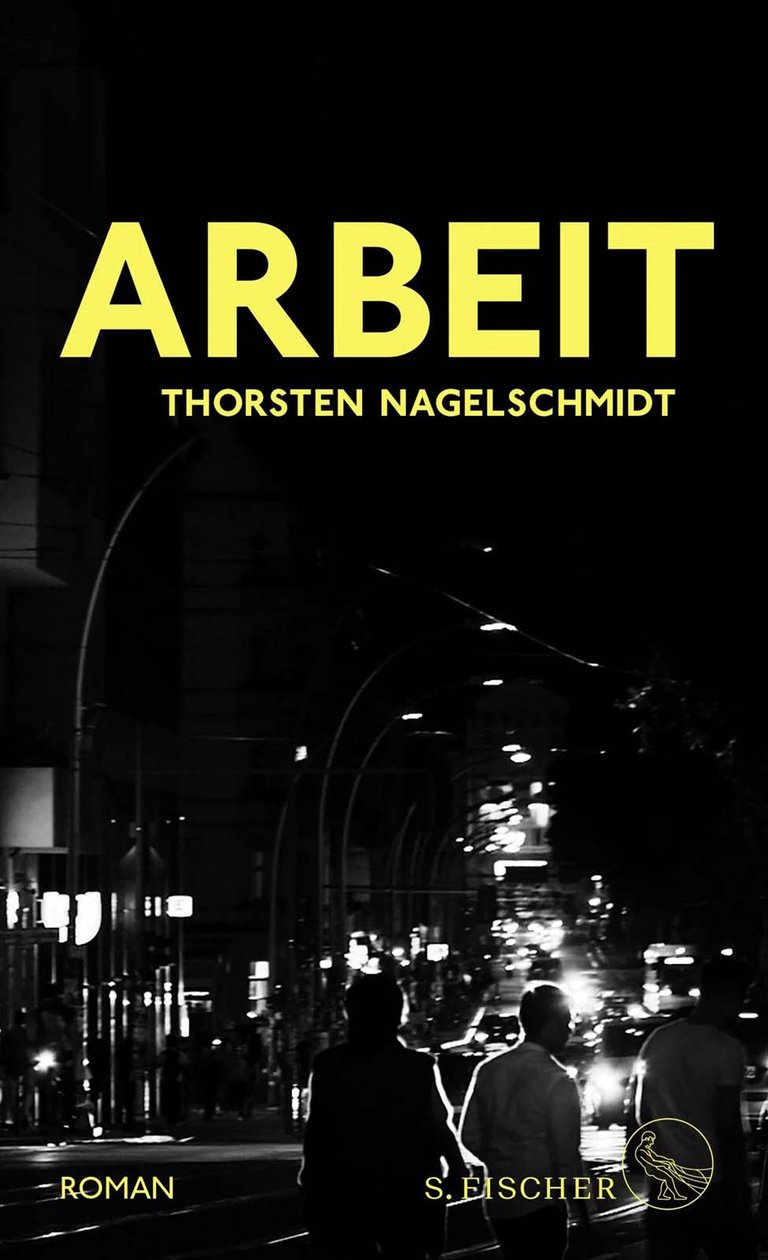
Deine Figuren leben, wie man sagt, am Rande der Gesellschaft. Wolltest du Sichtbarkeit schaffen, oder sind das einfach die spannenderen Charaktere?
Mich haben diese Perspektiven gereizt, weil man so wenig davon hört. Gerade in der deutschen Gegenwartsliteratur habe ich oft das Gefühl, dass da eine bestimmte Klasse oder Bildungsschicht Bücher schreibt für die Angehörigen derselben Bildungsschicht. Also, dass das so in sich geschlossen bleibt. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Ich finde es interessanter, die Literatur von diesem Sockel zu nehmen, auf dem sie für viele Leute steht und auf dem sie gar nicht stehen müsste.
Der Roman wurde von Kritikern als der „erste große Berlin-Roman des 21. Jahrhunderts“ beschrieben. Worin unterscheidet sich dein Buch von den üblichen Geschichten über Berlin?
Es wird ja wahnsinnig viel über Berlin geschrieben. Die New York Times macht wieder einen Artikel über das Berghain und es geht wieder um die Clubbetreiber, um die DJs und die Party People, um EasyJet-Berlin-Touristen. Das sind die Geschichten, die da so erzählt werden. Das ist auch alles interessant, ich will das überhaupt nicht schmälern. Aber mir ist aufgefallen, es fehlen die Perspektiven von den Menschen, die arbeiten, also die das alles überhaupt möglich machen, und zwar nicht aus Gründen der Selbstverwirklichung, sondern um das Geld für die Miete auf den Tisch zu bringen. Die werden häufig einfach übersehen.
Früher hieß es immer „In Berlin, da arbeitet keiner, da feiern alle nur.“ Aber schon damals habe ich gedacht, warte mal, aus dieser Denke spricht eigentlich eine ziemliche Ignoranz, weil man nicht sieht oder nicht sehen will, dass manche Leute arbeiten müssen, damit andere feiern können. Und aus diesem Grund fand ich es auch so schön und ein bisschen provokativ, diesem Roman den Titel Arbeit zu geben.
Viele Figuren kamen mir sehr bekannt vor, so als hätte ich sie schon mal getroffen. Wie schafft man es, ein individuelles Schicksal zu skizzieren und trotzdem so für Berlin typische Biografien abzubilden?
Es gibt keine 1:1-Vorlagen. Ich habe einfach viel recherchiert. Ich habe viele Interviews geführt, habe mit wahnsinnig vielen Menschen geredet, war nachts unterwegs, habe ein paar der Jobs selbst gemacht oder bin zumindest mal dabei gewesen, habe danebengestanden. Ich habe auch viel gelesen, viele Filme und Reportagen geschaut. Aber vor allem habe ich einfach viel hingehört, zugehört und genauer hingesehen.
Dein Begriff der Arbeit ist relativ weit gefasst. Deine Figuren sind unter anderem ein Taxifahrer, eine Sanitäterin, eine Lieferkurierin, aber es gibt auch Felix, der Dealer ist, und Ingrid, die ihr Einkommen mit Pfandsammeln aufbessert. Haben sie deinen Blick auf die Berufe geändert?
Das hat mir schon einen ganz anderen Blick gegeben, nicht nur auf die einzelnen Berufsgruppen, sondern auch auf das Thema Arbeit an sich. Ich habe festgestellt, dass Menschen sehr gerne über ihre Arbeit reden, wenn sie das Gefühl haben, dass man sich ehrlich dafür interessiert. Die erste Reaktion bei vielen ist, „ach meine Arbeit, weißt du, das ist so langweilig, ich mach immer dasselbe, das willst du gar nicht wissen“. Wenn man dann aber nochmal nachhakt, merkt man, dass es das Bedürfnis gibt, darüber zu reden. Selbst wenn es ein mies bezahlter Scheißjob ist oder ein Bullshitjob oder was auch immer. Weil Arbeit nun mal eine große Rolle im Leben der meisten Menschen spielt, allein schon, weil man so viel Zeit damit verbringt oder verbringen muss. So dass die meisten doch froh sind, wenn darüber mal geredet wird, selbst wenn es nur darum geht, sich mal auskotzen zu können. Das war mir, bevor ich mich so intensiv mit diesen Fragen beschäftigt habe, nicht so klar.
Fehlt es diesen Menschen an Wertschätzung?
Ja, und vielleicht gilt das auch ganz besonders nochmal für Dienstleistungsberufe. Dass das auch jemand machen muss, dass da ein Mensch mit seinen privaten Problemen und unterschiedlichen Tagesformen hinter steckt, da denken viele vielleicht nicht so drüber nach, wenn sie sich eine Pizza bestellen oder ein Taxi rufen. Und dann ist es ja auch oft so, dass die gesellschaftliche Anerkennung fehlt. Also erstmal die finanzielle Anerkennung, weil viele dieser Berufe einfach schlecht bezahlt sind. Wenn man sich beispielsweise überlegt bei einer Notfallsanitäterin, wie viel Verantwortung sie hat, wie krass ihre Arbeitszeiten sind und wie dann die Entlohnung ist – das ist ja himmelschreiend, völlig grotesk.
Hast du mit den Interviewten noch mal nach der Veröffentlichung gesprochen? Wie waren die Reaktionen?
Ja, mit einigen schon. Ich habe auch allen, die ich ausfindig machen konnte, ein Buch zukommen lassen und viele haben sich gefreut, dass sie etwas dazu beisteuern konnten oder so etwas gesagt wie: Danke, dass du das mal aufgeschrieben hast. Man muss sich wirklich mal bewusst machen, dass es in der deutschen Gegenwartsliteratur keinen Roman gibt, wo die Hauptfigur als Sanitäter arbeitet. So ein interessanter Beruf, und es ist noch niemand darauf gekommen. Oder Marcella, die Fahrradlieferantin. Ich meine, wir alle sehen sie den ganzen Tag an uns vorbeifahren oder uns unser Essen bringen, in der Literatur aber finden sie einfach nicht statt. Interview: Rita Schuhmacher