Ausgabe 04/2025
Zwei Jobs für das Superhuhn
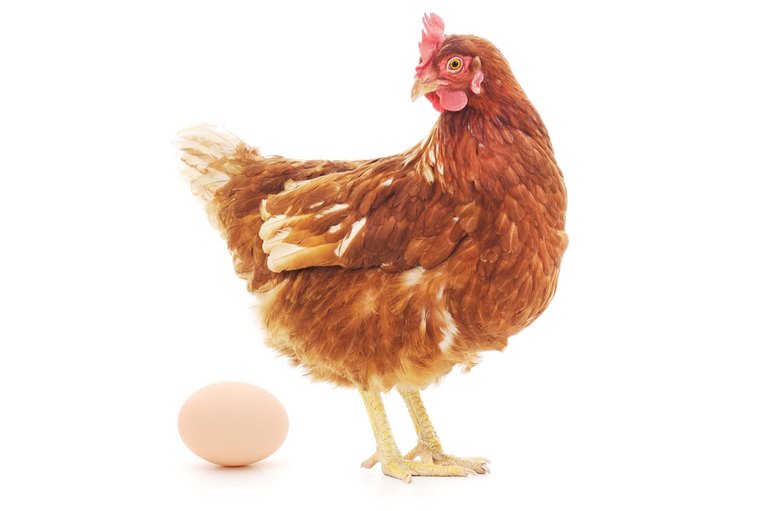
Eier werden immer beliebter. 249 Stück vertilgte eine Durchschnittsperson in Deutschland im vergangenen Jahr – 35 mehr als zu Beginn des Jahrtausends. Tatsächlich enthalten Eier viele Proteine, Vitamine und Mineralstoffe, die der menschliche Körper gut verwerten kann. Dabei sind sie kalorienarm. Wegen des Cholesterins empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zwei bis drei Eier pro Woche.
Mit dem wachsenden Eierkonsum mussten auch die Hühner produktiver werden. Legte ein Tier 1955 durchschnittlich 118 Eier, so waren es im vergangenen Jahr 302. Dahinter stehen wenige Zuchtkonzerne, die den weltweiten Legehennenmarkt beherrschen. Wer heute weiße Eier kauft, unterstützt meist die Erich Wesjohann GmbH & Co KG (EW) aus Niedersachsen, die in 45 Ländern präsent ist und etwa 19.000 Menschen beschäftigt. Braune Eier stammen weltweit zu zwei Dritteln von Hühnern, die das niederländische Unternehmen Hendrix Genetics züchtet. Die Genetik der dort entwickelten Rassen ist Geschäftsgeheimnis.
Bankiva, das Ur-Huhn
Der Ur-Ahn aller Haushühner ist das aus Asien stammende Bankiva-Huhn. Das Wildtier legt acht bis zwölf Eier pro Jahr und ist im Vergleich zu heutigen Stallhühnern ein Zwerg. In den vergangenen 3.000 Jahren entwickelten Bäuerinnen und Bauern daraus hunderte Rassen, angepasst an regionale Gegebenheiten und menschliche Vorlieben. Meist ging es da um Eier, seltener um Hahnenkämpfe. Die Tiere lebten einige Jahre und landeten irgendwann im Suppentopf oder starben eines natürlichen Todes.
Hühner sind grundsätzlich pflegeleicht und suchen ihr Futter meist selbst in Form von Würmern und Körnern. Bei alten Haustierrassen legen Hennen alle paar Tage ein Ei und glucken ab und zu – nach 21 Tagen schlüpfen die Küken. Nach 22 bis 23 Wochen sind die Tiere geschlechtsreif und legen selbst Eier. So läuft es weltweit bei vielen Kleinbauern noch heute, sofern sie alte Rassen halten. Doch inzwischen dominieren auch im Biobereich in Deutschland Hennen aus industrieller Züchtung.
Dass Hühner zudem gutes, fettarmes Fleisch liefern, rückte in den USA vor knapp hundert Jahren in den Fokus der industriellen Landwirtschaft. Hähnchen landeten in den 1960-er Jahren zunächst auf dem Grill deutscher Wienerwald-Restaurants. Heute ist der niedersächsische Konzern PHW mit Marken wie Wiesenhof führend im Mastbereich. In 45 Tochterfirmen, darunter Wiesenhof, arbeiten rund 11.000 Menschen. Chef ist Paul-Heinz Wesjohann, Bruder von Eierbaron Erich – beides Multimilliardäre.
Im Mastbereich geht es darum, dass die Tiere rasch an Gewicht zulegen und eine große Brust ausbilden – so wünschen es die Kunden. Wenn die Hühner nach 30 bis 42 Tagen aus ihrem kurzen, harten Leben scheiden, wiegen sie bis zu 45-mal so viel wie beim Schlüpfen. Um ein Kilo Fleisch anzusetzen, brauchen sie gerade mal 1,5 Kilogramm Futter, weil ihr Magen-Darm-Trakt auf die Aufnahme von wenig, aber überaus proteinreichem Futter optimiert ist. Das Sojafutter stammt größtenteils aus Lateinamerika; die Vertragslandwirte erhalten genaue Vorgaben für Futter und Stallausstattung.
Nur noch zwei Zuchtlinien
In der industriellen Hühnerzucht existieren inzwischen zwei völlig getrennte Zuchtlinien für Eier- und Fleischproduktion. Ihre enormen Leistungen entstehen durch Kreuzung zweier Rassen, halten aber nur für eine Generation. Somit können Landwirt*innen die Tiere nicht mehr selbst vermehren, sondern müssen ständig neue Hühner kaufen. Damit ist eine zentrale Funktionsweise der Natur und der jahrtausendelangen Landwirtschaft ausgehebelt. Das Prinzip der Hybridzüchtung erfand die US-amerikanische Saatgutfirma Pioneer Hi-bred zunächst für Mais, später auch für Hühner.
Diese Inzucht hat die Bestände genetisch verarmt. Viele traditionelle Hühnerrassen sind verschwunden oder vom Aussterben bedroht, ebenso Schweine und Rinder. Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass durchschnittlich jeden Monat eine von 8.000 Nutztierrassen verschwindet. Das ist gefährlich: Hochertragstiere haben eine geringe genetische Varianz und teilen Schwächen im Immunsystem. Weil sie auf engstem Raum zusammenleben müssen, können Krankheiten ganze Bestände auslöschen.
So wütete die Vogelgrippe 2022 in vielen Ställen. Allein in den USA wurden 170 Millionen Vögel getötet, in Europa gab es 650 Ausbrüche. Die Geflügelindustrie erkennt inzwischen das Problem, setzt aber eher auf technische Manipulation einzelner Gene statt die Erbgutverarmung grundsätzlich zu hinterfragen. Ein internationales Team fand heraus, dass fast alle 39 hochansteckenden Geflügelviren in Industrieställen entstanden sind.
Auf einen Blick
249 Eier pro Person in Deutschland wurden 2024 durchschnittlich gegessen – 35 mehr als zu Beginn des Jahrtausends
118 Eier legte ein Huhn 1955 durchschnittlich pro Jahr
302 Eier legt ein Huhn heute im Durchschnitt pro Jahr
30 bis 42 Tage lebt ein Fleischhuhn bis zum Schlachtgewicht von bis zu 45-mal seines Schlupfgewichts
170 Millionen Vögel wurden 2022 in den USA wegen Vogelgrippe getötet
650 Ausbrüche von Vogelgrippe gab es im selben Jahr
110.000 Zweinutzen-Küken schlüpfen jährlich auf dem Bio-Geflügelhof Bodden südlich von Kleve, die auf natürliche Weise entstehen, regional angebautes Futter fressen und nachzüchtbar sind
174 Hühnerrassen listen Universität Göttingen und Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in einer Datenbank
Die Universität Göttingen und das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit verfolgen einen anderen Ansatz. Sie haben eine öffentliche Datenbank mit 174 kommerziellen und traditionellen Hühnerrassen erstellt und darin die genetische Diversität innerhalb und zwischen den Populationen dokumentiert. "Für Nachhaltigkeit und Flexibilität der Zucht ist es wichtig, diese unterschiedlichen Rassen zu erhalten", erklärt Henner Simianer, Professor für Tierzucht und Haustiergenetik.
Ein weiteres Problem: In der Eierindustrie sind männliche Küken überflüssig. Das routinemäßige Töten der kleinen Hähne ist in Deutschland seit 2022 verboten. Einige Brutbetriebe verlagerten es ins Ausland, wo das Schreddern oder Vergasen weiter praktiziert wird. Neue Techniken ermöglichen die Geschlechtsbestimmung im Ei am 12. Tag, um männliche Embryonen früh zu töten.
Einige Betriebe ziehen "Bruderhähne" auf. Diese Mast dauert länger, das Fleisch ist fester und dunkler, die Brust kleiner als die der optimierten Hähnchen. Sie sind in Hofläden oder bei engagierten Händlern erhältlich. Ein Großteil der Bruderhahnaufzucht findet außer Landes statt, oft unter schlechten Bedingungen, wie Tierschützer belegt haben.
Dem Zweinutzentier geht es besser
Die wirkliche Alternative zu alledem sind sogenannte Zweinutzentier-Hühner. Sie legen relativ viele Eier und liefern gutes Fleisch, sind aber keine Hochertragstiere. Für ihre Zucht setzen sich Bioverbände ein. So schlüpfen etwa auf dem Geflügelhof Bodden südlich von Kleve jedes Jahr rund 110.000 Küken, die auf natürliche Weise entstehen, regional angebautes Futter fressen und nachzüchtbar sind. Die Eier und das Fleisch sind teurer als die der Brüder Wesjohann. Doch ist weniger vielleicht mehr, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch aus Gesundheitsgründen empfiehlt? Darüber hinaus gibt es inzwischen auch pflanzliche Eier aus Mungobohnen oder Kichererbsen hergestellt und die sind zudem sogar noch klimafreundlicher als die tierischen Produkte.