Ausgabe 06/2025
Zwischen Kapital und Klasse

ver.di publik: Welche Situation am Arbeitsmarkt hat Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von seinem Amtsvorgänger Jair Bolsonaro geerbt?
Ricardo Antunes: Der brasilianische Arbeitsmarkt hat, wie auch in anderen Teilen der Welt, einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Unter Bolsonaro kam es zu heftigen Angriffen auf die Rechte der Arbeiter*innen. Aber bereits vor Bolsonaro, unter Michel Temer, gab es die Arbeitsgegenreform. Ich nenne sie Gegenreform und nicht Arbeitsreform, weil sie viele wichtige Errungenschaften zerstörte und darauf abzielte, die Gewerkschaften zu schwächen. Diese Gegenreform von 2017 schuf ein verhängnisvolles Konstrukt, nämlich die intermittierende Arbeit. Wenn es Arbeit gibt, arbeite ich. Wenn es keine Arbeit gibt, dann nicht. Und es gibt de facto keine Rechte. Kurz gesagt: Unter Temer und Bolsonaro gab es eine Liberalisierung für Kapital und Unternehmen, die eine Kombination aus Ausbeutung und Enteignung der Arbeiterklasse ermöglichte.
In den ersten beiden Amtszeiten Lulas waren die Gewerkschaften wichtige Verbündete. Wie ist die Beziehung zwischen Gewerkschaften und Regierung heute?
Während der ersten beiden Amtszeiten Lulas von 2003 bis 2011 waren die Gewerkschaften noch relativ stark. Insbesondere unter Temer und Bolsonaro wurde die explizite Politik der Zerstörung der Gewerkschaften dann ungebremst vorangetrieben. Nur ein Beispiel: Die Gewerkschaften in Brasilien lebten seit den 1930er Jahren von einer sogenannten Gewerkschaftssteuer. Jeder Arbeitnehmer war verpflichtet, den Lohn eines Arbeitstages pro Jahr für seine jeweilige Gewerkschaft oder ihren Dachverband zu zahlen – ein obligatorischer Beitrag. Temer hat die Gewerkschaftssteuer mit der Arbeitsreform von 2017 abgeschafft.
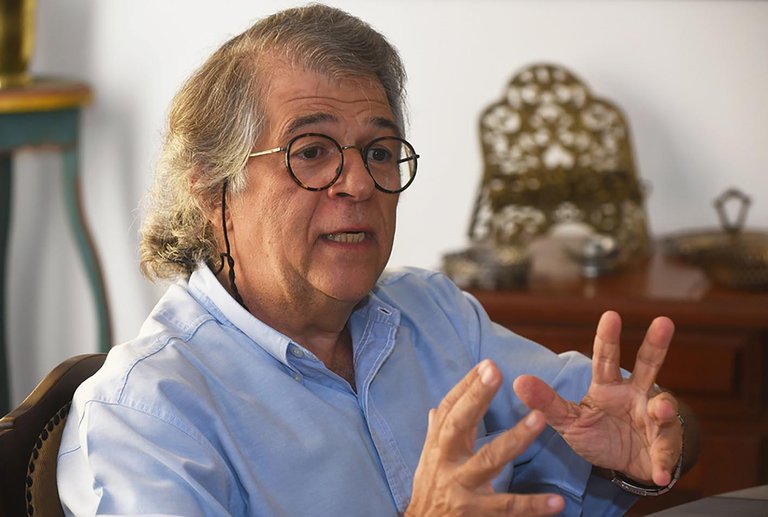
Welche Auswirkungen hatte das?
Die Gewerkschaften verloren viel Geld für die Gewerkschaftsarbeit. Unter dem Druck des Neoliberalismus und einer aggressiven Politik der Bourgeoisie verloren die Gewerkschaften viel von ihrer Kraft. Viele schlossen sich dem an, was ich provokativ als "staatliches Verhandlungsgewerkschaftswesen" bezeichne. Das heißt, weniger Konfrontation und mehr Verhandlungen mit dem Staat. Im Wahlkampf sagte Lula, dass er Temers Reform rückgängig machen werde. Lula ist seit drei Jahren im Amt und er hat nicht die geringste Maßnahme ergriffen, um die Arbeitsgegenreform aufzuheben.
Warum tut er nichts?
Lula hat keine strengeren Maßnahmen gegen die Reform ergriffen, weil seine Regierung auf Schlichtung setzt. Lula hat die Wahlen nur sehr knapp gegen Bolsonaro gewonnen. Seine Regierung stützt sich auf eine breite politische Allianz bis hin zu früheren Neoliberalen und gemäßigteren Bolsonaristen. Lula hat die Illusion, dass er eine positive Regierung für die Arbeiter*innen bilden kann, ohne die Unterstützung von Teilen der Bourgeoisie zu verlieren.
Seine Erfolge sind bisher gering: Die Arbeitslosenquote ist gesunken, der Mindestlohn ist gestiegen …
Es ist richtig, dass es in Lulas dritter Amtszeit eine kleine, aber reale Erhöhung des Mindestlohns gab. Denn unter Bolsonaro und Temer gab es eine reale Lohnkürzung. Aber der brasilianische Mindestlohn beträgt derzeit 1.500 Reais, das sind umgerechnet 300 Dollar – ein miserabler Monatslohn. Lula hat viele Ressourcen in die Industrie, den Agrarsektor und andere Wirtschaftsbereiche gesteckt, was eine Ausweitung der Lohnarbeiterschaft fördert. Die Wirtschaft wächst und wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote der letzten 10, 12 Jahre. Aber es gibt auch immer noch viele Arbeitslose.
In ihren Arbeiten sprechen Sie von einer "Uber-isierung" der Arbeit, einem neuen Dienstleistungsproletariat im Bereich digitaler Plattformen.
Seit den 2000er Jahren erleben wir eine zunehmende Informalität und Prekarisierung von Arbeit. Dieser Prozess hat sich in jüngerer Zeit verschärft. Meiner Meinung nach ist dies heute die entscheidende Herausforderung angesichts der Explosion dessen, was ich als das neue Dienstleistungsproletariat des digitalen Zeitalters bezeichne, das keinerlei Rechte hat: die Uber-Fahrer*innen, die Lieferant*innen von iFood oder Deliveroo, kurz: die Arbeiter*innen der ständig expandierenden digitalen Plattformen. Und die Zahl dieser Arbeitnehmer*innen wächst weiter.
Welche Maßnahmen ergreift die Regierung?
Lula legte 2023/24 einen Gesetzentwurf vor, wonach diese Arbeitnehmer*innen selbstständig sind und daher von der Sozial- und Arbeitsschutzgesetzgebung ausgenommen sein sollten. Viele von uns, mich eingeschlossen, kritisierten dies scharf. Sie verdienen nur, wenn sie arbeiten. Es gibt keine Feiertage, keine wöchentliche Ruhezeit, keinen Urlaub, keine Krankenversicherung. Zugleich gibt es eine starke Propaganda gegen Gewerkschaften in diesem Sektor.
Welche Auswirkungen hat die Zunahme informeller Tätigkeiten auf die Arbeit der traditionellen Gewerkschaften?
Die traditionellen Gewerkschaften sind im Allgemeinen sehr männlich, mit geringer Präsenz von Frauen, sehr geringer Präsenz von Farbigen und keiner Präsenz von Immigranten. Sie müssen sich ändern, denn die Arbeiterklasse, jene Klasse, die von ihrer Arbeit lebt, ist heterogener, komplexer und fragmentierter geworden. Eine neue Morphologie der Arbeit und der Arbeiterklasse bringt eine neue Morphologie der sozialen Kämpfe hervor. Und genau das müssen wir anfangen zu untersuchen und zu verstehen. INTERVIEW: Andreas Knobloch