Ausgabe 01/2022
Ein barbarisches Jahrzehnt

Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder
Was waren die Neunziger? Eine Frage, die Westdeutsche anders beantworten würden als "gelernte DDR-Bürger". Den einen fiele die Spaß-gesellschaft ein: Comedy, Eurodance und Super Mario. Den anderen käme auch solches in den Sinn: Treuhand, Plattenbau und Neonazis. Im Oktober 2018 erschien in der taz der autobiografisch fundierte Essay Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz, der dieser eindimensionalen Sicht etwas entgegensetzt. Er nahm die Perspektive derer ein, die damals zu alt waren, um nichts von der DDR mitbekommen zu haben, und zu jung, um mitreden zu können über die Zukunft. Schulz, Jahrgang 1979, beschrieb die Nachwendezeit als "barbarisches Jahrzehnt", das verwickelter war, als manches Urteil über "den Osten" es heute behauptet.
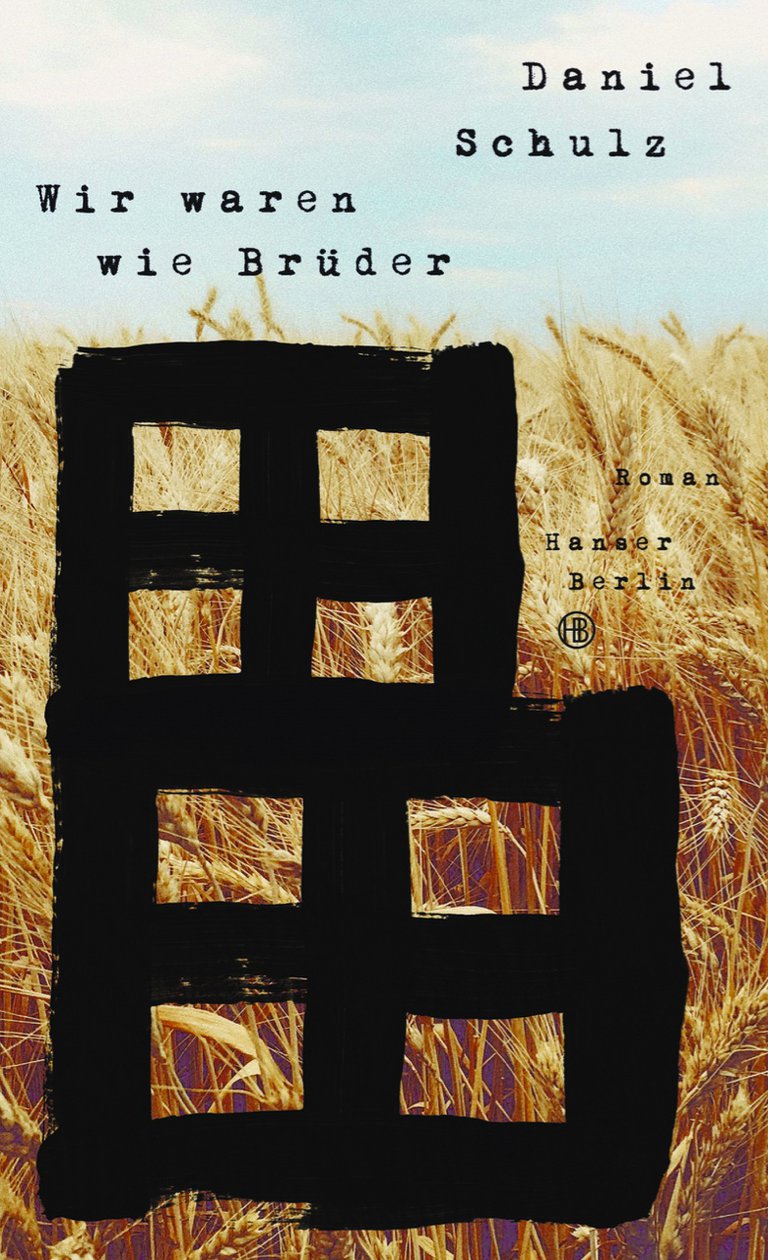
Angesichts der Resonanz auf den preisgekrönten Beitrag verwundert es nicht, dass Schulz sich entschied, die ganze Geschichte zu erzählen. Noch weniger verwundert, dass er für sein nun erschienenes Buch die Form des Romans gewählt hat. Die Kompliziertheit der Dinge verlangt eben manchmal nach wahrhaf- tiger Literatur statt wissenschaftlicher Evidenz. Der Ich-Erzähler berichtet vom Aufwachsen in der brandenburgischen Provinz von 1989 bis 2000, zwischen Faschos und Familie, Anpassung und Abgrenzung, Gewalt und Gemeinschaft. Schulz zielt auf Erzählung statt Bewertung und beweist, dass in einer Gesellschaft jede Wirkung auf Ursachen zurückgeht. Weniger als 300 Seiten braucht er, um das Erstarken der rechten Szene in starken Bildern plausibel zu machen. Dass dies gelingt, ohne Leute zu denunzieren, ist eine besondere Leistung dieses Werkes.
Sprachlich besticht der Text durch präzise Beobachtungen, die den Alltagsszenen in einer aggressiven Umgebung eine zärtliche Poesie verleihen. Angst, Freude und Verrat gehen bisweilen fließend ineinander über. Hier wird nichts beschönigt, aber auch niemand dämonisiert. Der Protagonist erlebt einen "sozialen Aufstieg" von der unteren Mitte in die Sphäre verwöhnter Gymnasiasten. Ihm stößt die richtige Liebe im falschen Menschen zu. Er sucht Halt auf der schiefen Bahn zwischen seinem Hass auf die Verarmungspolitik der neuen gesamtdeutschen Regierung und seinem Ekel gegen den sich ausbreitenden Rassismus. Und er findet am Ende so etwas wie seinen eigenen Weg, wundersam scheiternd und verbunden mit einem ewigen Hadern, das die biografische Bürde ihm auferlegt hat. Christian Baron
Hanser Berlin, 288 S., 23 €

Mieko Kawakami: Heaven
Er schielt, sie stinkt – beide werden brutal von ihren Mitschüler*innen gemobbt. Nachdem Kojima ihm eines morgens heimlich einen Zettel mit der Nachricht "Wir gehören zur selben Sorte" zusteckt, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden Außenseitern. Er kann nichts für sein Schielen, für sie ist ihr schludriges Aussehen ein selbstgewähltes, bedeutungsvolles Zeichen. Nichtsdestotrotz macht ihre Andersartigkeit die beiden zu Opfern. Gemeinsam suchen sie nach Überlebensstrategien und finden dabei zwei sehr unterschiedliche Wege. Die japanische Autorin, die mit ihrem 2020 erschienen Roman "Brüste und Eier" internationale Erfolge feierte, erzählt hier einfühlsam, aber nie sentimental. Im Gegenteil, sie beschreibt Gewalt in aller Härte und arbeitet sie in einigen Schlüsseldialogen präzise als ein unumgängliches, menschliches Phänomen heraus. Düster und fesselnd ist die Lektüre, weil diese Geschichte weit über das Erleben zweier Teenager hinausgeht, hin zu einer Erzählung über das Schwachsein in einer Gesellschaft der Starken.
Feline Mansch
DuMont Verlag, 190 S., 22 €
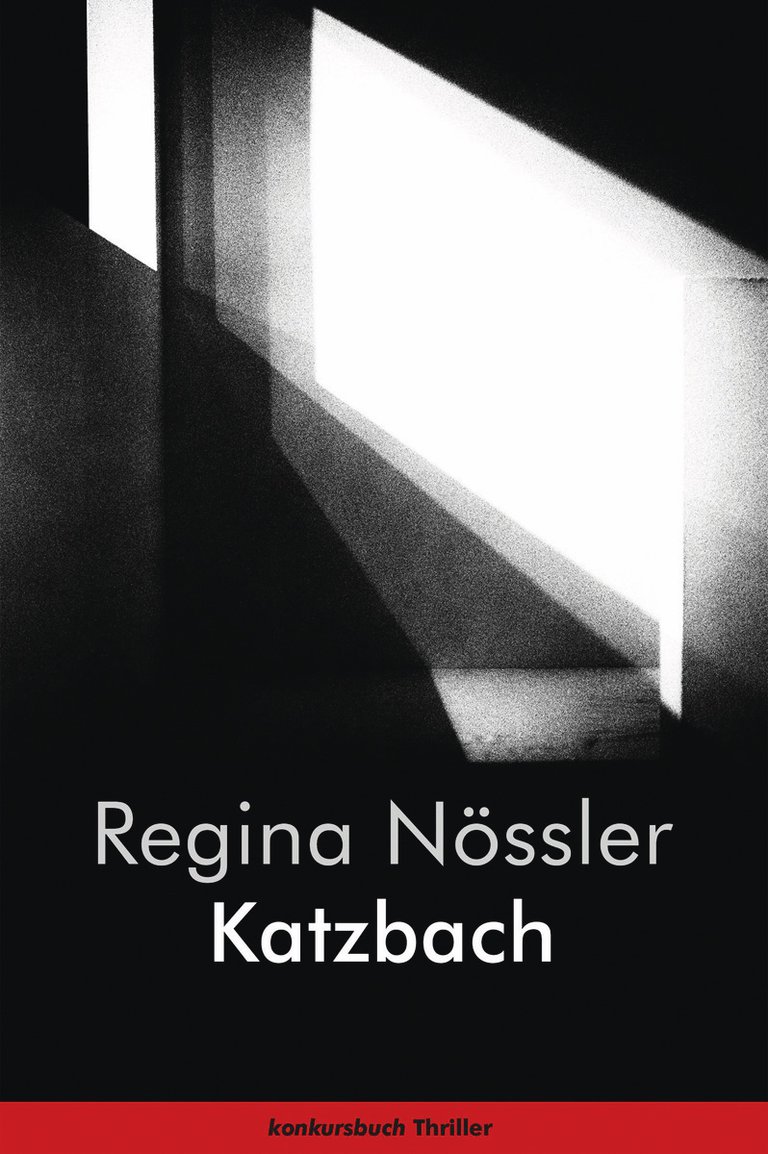
Regina Nössler: Katzbach
Isabel Keppler ist unsympathisch, schroff, missmutig, erfolglos und gefühlskalt. Regina Nössler hat ihre Protagonistin mit vielen unangenehmen Charaktereigenschaften ausgestattet, die Singlefrau ist niemand, mit dem man sich identifizieren, geschweige denn mitleiden möchte. Keppler ist – wie ihre Erfinderin – eine Meisterin der scharfen Beobachtung, unbarmherzig spürt sie Schwächen und Angriffsflächen ihrer Mitmenschen auf, nutzt sie für sich und ihre Vorstellung von einem autarken Leben ohne Beziehungen und Verpflichtungen. Sie arbeitet nach mehreren abgebrochenen Studien in zwei ungeliebten Jobs und hütet eine alte Dame, die sie verabscheut und auch so behandelt. Sie wohnt im Souterrain einer lauten und schmutzigen Berliner Straße zur Untermiete. Die Autorin zieht ihre Leserschaft so intensiv in ein äußerst raffiniert gesponnenes Geschehen, bis man nur noch wissen will, was mit dieser 39-Jährigen eigentlich passiert, die sich durch Vernissagen trinkt und die Kunstkennerin gibt. Ein Strudel rätselhafter Ereignisse wirbelt ihr einsames Leben durcheinander. Souverän beherrscht Nössler die genretypischen Thrillerzutaten – dunkle Parks, schuldhafte Verstrickungen, undurchsichtige Gestalten – und treibt mit Hilfe verschiedener Zeitebenen und wechselnder Erzählperspektiven die Spannung voran. Und dann liegt eine Leiche dort, wo sie keinesfalls liegen bleiben kann… Aber nichts ist so, wie es scheint. Und das macht einen guten Krimi aus. Ulla Lessmann
Konkursbuch, 348 S., 12,90 €